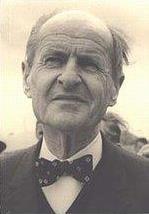Präambel
In der Absicht, den wissenschaftlichen Nachwuchs auf dem Gebiete des griechisch-römischen Altertums zu fördern, stiftet die Mommsen-Gesellschaft einen Preis für hervorragende Arbeiten auf den von ihr vertretenen Gebieten. Die Gesellschaft würdigt insbesondere Ergebnisse von interdisziplinärer Bedeutung in den altertumswissenschaftlichen Fächern.
§ 1
Der Preis wird alle zwei Jahre auf der wissenschaftlichen Tagung der Gesellschaft vergeben. Die/Der Erste Vorsitzende vollzieht den Akt der Preisverleihung mit einer kurzen Laudatio, die jeweilige Preisträgerin/der jeweilige Preisträger stellt ihre/seine Arbeit in einem Referat von maximal 30 Minuten vor.
§ 2
Der Preis ist mit 3.000 Euro aus dem Kapital der Gesellschaft dotiert.
§ 3
Vorschlagsrecht haben die Mitglieder der Gesellschaft.
§ 4
Eingereicht werden können Arbeiten von Nachwuchswissenschaftlern, deren Abschluss nicht länger als zwei Jahre (vom Abschluss des Prüfungsverfahrens bis zum Termin der Bewerbung an gerechnet) zurückliegt.
§ 5
Die Jury wird jeweils von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes gewählt. Sie besteht aus drei Mitgliedern, nämlich je einer Wissenschaftlerin / einem Wissenschaftler aus dem Bereich der Klassischen Philologie, der Alten Geschichte sowie der Klassischen Archäologie, die jedoch nicht dem neuen Vorstand angehören und eines der Jurymitglieder zur/zum Juryvorsitzenden bestimmen.
Nähere Bestimmungen
§ 6
Bewerbungen sind bis spätestens 6 Monate vor Beginn der nächsten Tagung an die/den Juryvorsitzende/n zu richten, von der/dem der Vorstand zeitnah über die eingegangenen Bewerbungen in Kenntnis gesetzt wird. Einzureichen sind eine Zusammenfassung der Arbeit von drei bis fünf Seiten und eine elektronische Version der Arbeit sowie in der Regel die Gutachten. Die Jury kann im Verlauf des Verfahrens zusätzlich das komplette Manuskript in einer Druckfassung anfordern. Wiederholte Einreichung derselben Arbeit ist nicht möglich.
§ 7
Eventualien (wie z. B. Berücksichtigung der Finanzlage der Gesellschaft, Nichtvergebung des Preises usw.) werden nicht kasuistisch normiert, sondern jeweils vom amtierenden Vorstand mit der Jury geregelt.