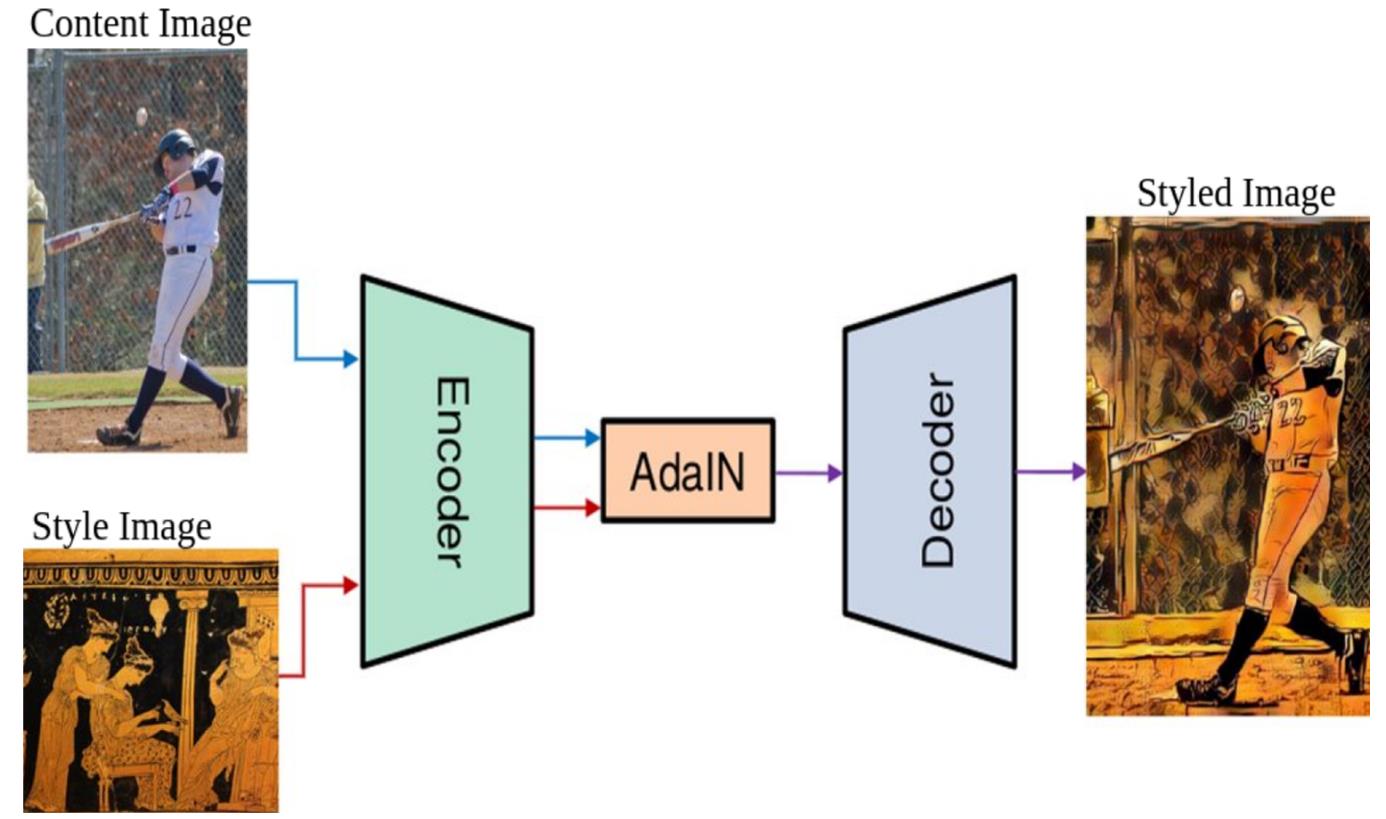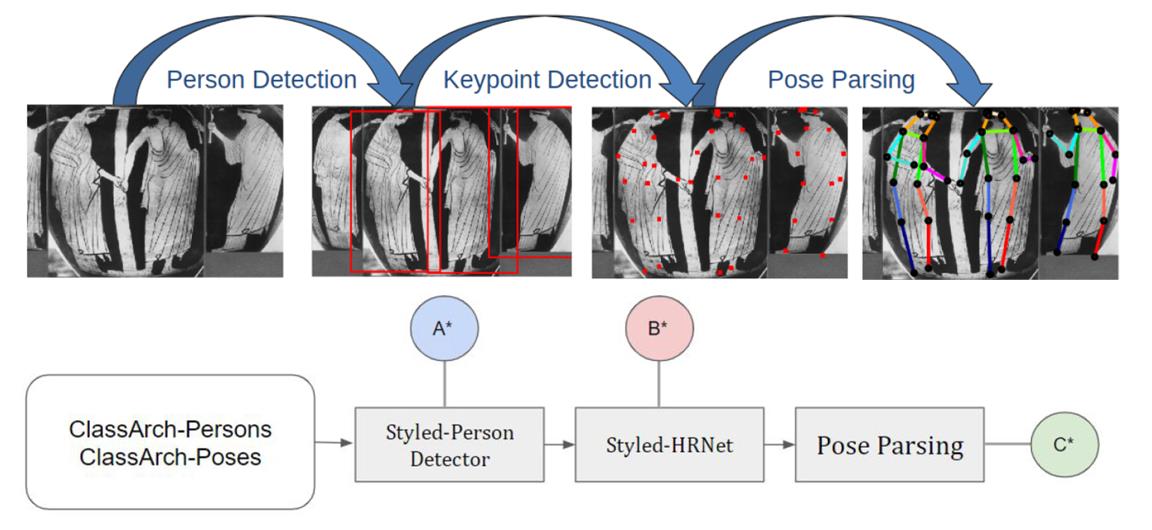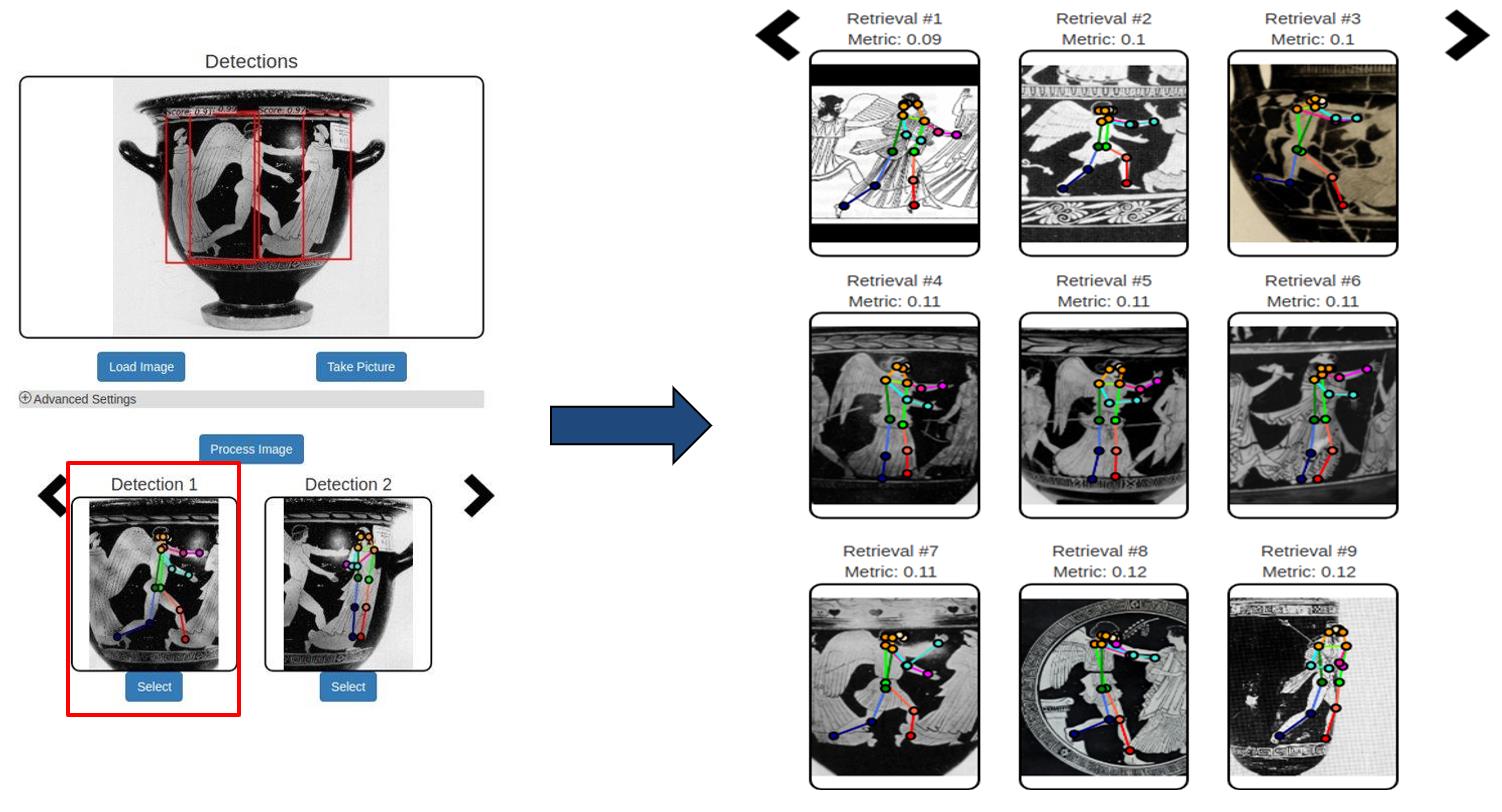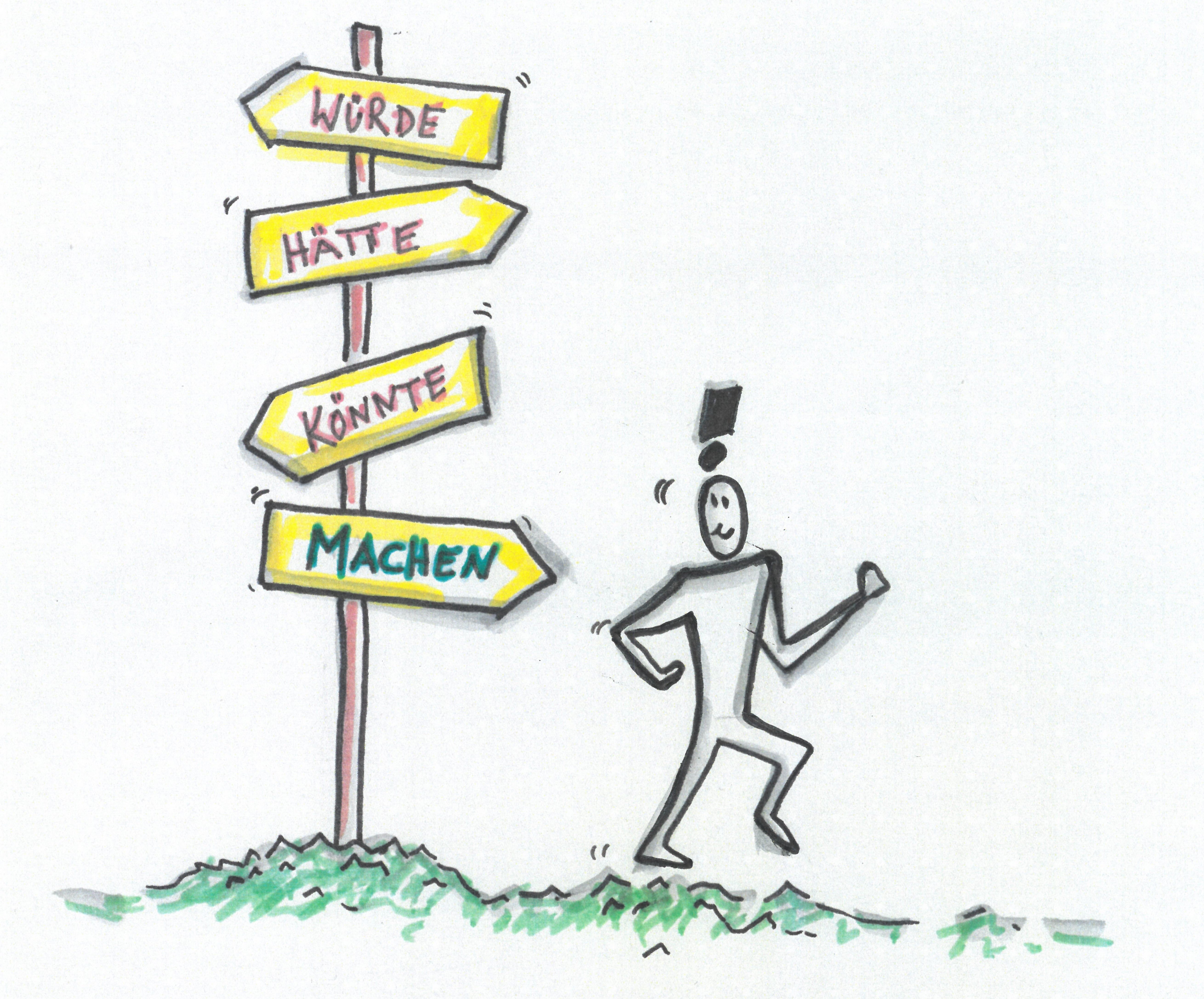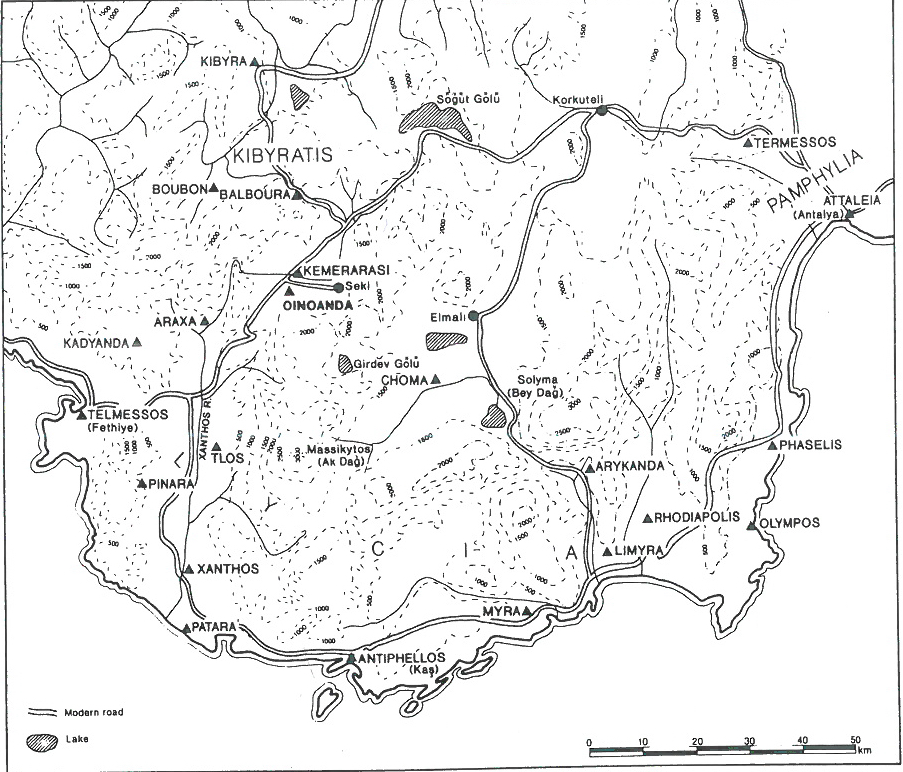Palmyras besondere Lage „inter duo imperia“ hat schon seit Plinius die Fantasie westlicher Autoren angeregt. Bis zu ihrer weitgehenden Zerstörung durch den IS waren ihre romantischen Ruinen ein steter Anziehungspunkt für Abenteurer, Schriftsteller und Touristen. Die etwa auf halbem Wege zwischen Mittelmeer und Euphrat gelegene Oasensiedlung von Tadmor war zwar schon in der Bronzezeit besiedelt, aber fassbare epigraphische Befunde gibt es erst ab der zweiten Hälfte des Ersten Jahrhunderts vor Christus. Ab diesem Zeitpunkt findet sich ein über drei Jahrhunderte bis zum Jahr 274 n. Chr. hinweg umfassendes Corpus aus mehr als dreitausend Inschriften. Die Mehrzahl dieser Inschriften wurde auf palmyrenisch verfasst, einem lokalen Dialekt des syrischen, dessen Entschlüsselung maßgeblich auf die Arbeit französischer Forscher des 18. Jahrhunderts zurückgeht. Das Spektrum der aramäischen Inschriften reicht von wenigen Zeichen langen Graffiti über die Widmungen von Opferaltären und zahlreiche in den Nekropolen der Stadt überlieferte Grabinschriften bis hin zu Monumentalen Ehreninschriften. Zusätzlich finden sich mehrere hundert bilinguale oder rein griechischsprachige Inschriften, die zumeist der öffentlichen Sphäre zugeordnet werden können: Sie stehen an der Fassade monumentaler Grabtürme, auf den Sockeln von Statuen oder in Tempeln. Lateinische Inschriften sind dagegen selten und kommen quasi nur in Verbindung mit aramäischen oder griechischen Texten vor. So bunt die Textsorten sind, so weit verstreut sind auch ihre Fundorte: Die palmyrenischen Handelsaktivitäten und der Dienst in Hilfstruppeneinheiten des römischen Heeres sorgten dafür, dass sich Zeugnisse der palmyrenischen Diaspora vom Hadrianswall über Rom, Africa Proconsularis, Ägypten und Dacia bis hin zur Festungsstadt Dura Europos am Euphrat verstreut finden.
Ziel des von der DFG geförderten Projekts der Prosopograhia Palmyrena ist es dementsprechend, sämtliche bekannten Informationen über die in diesem Inschriftenkorpus benannten Personen zu sammeln, sie in unterschiedlichen Kategorien zu ordnen und sodann in einer Datenbank zugänglich zu machen.
Bislang liegen Daten zu mehr als achttausend verschiedenen Individuen vor. Die gesammelten Informationen erstrecken sich dabei von Angaben zur Familien- und Stammesmitgliedschaft über die Art und Fundlage der errichteten Inschriften bis hin zu Angaben zur Berufs- und Religionsausübung.
Der spannendste und zugleich schwierigste Teil der Arbeit mit dem Datensatz ist dabei die Suche nach möglichen Identifikationen: Kann das Grab eines aus einer Ehrinschrift bekannten Mannes ausfindig gemacht werden? Können wir nachweisen, ob ein in Rom lebender Palmyrener Verwandte in Palmyra hatte? War der Anführer einer bestimmten Karawane vielleicht noch für andere Karawanen tätig? Erschwert wird diese Fragestellung durch den unterschiedlichen Informationsgehalt der einzelnen Inschriften.
So lautet etwa eine typische Grabsteleninschrift (PAT 0149):
zbdbwl br bwrpˀ ḥbl
Zabdibol, Sohn des Borpa, Ach!
Abgesehen von einer ausnehmend kurzen, patrilinearen Genealogie bietet diese Inschrift keinerlei Informationen über die soziale Stellung von Zabdibol oder seinem Vater. Da eine Datierung ebenso fehlt wie klare Informationen über die Fundlage bleiben nur die Namen der beiden Personen übrig.
Mangels Datierung und Fundort ist somit eine Identifikation selbst dann unsicher, wenn ein weiterer zbdbwl Sohn des bwrpˀ gefunden werden sollte.
Es gibt jedoch auch Fälle, in denen Onomastik, Genealogie, Datierungen und Fundort zusammen sehr sichere Datierungen ermöglichen. Ein gutes Beispiel dafür ist Hairan Sohn des Bonnes, Sohn des Rabbelu. Er ist zuallererst aus einer seltenen, von ihm selbst errichteten trilingualen Grabgründungsinschrift aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. bekannt:
Lat.
1 Haeranes, Sohn des Bonnes Sohn des Rabellus,
2 Palmyrener vom Stamm Mithenon,
3 errichtete dies für sich und die Seinen
Gr.
1 Im Jahr 363*, Monat Xandikos
2 Airan Sohn des Bonnes Sohn des Rabbelos,
3 Palmyrener vom Stamm Meithenos, für sich selbst
4 und Baalthega, seine Mutter
5 für ihre Verdienste und für die Seinen
Aram.
1 Im Monat Nisan des Jahres 363 wurde dieser Sarkophag des
2 Hairan, Sohn Bonnes, Sohn Rabbelus, Sohn Bonnes, Sohn Atentens, Sohn
3 Tymys des Tadmorers, der vom Stamm der Söhne des Mithenons ist gebaut; Auf (Geheiß von)
4 Bonnes, seinem Vater, und auf (Geheiß) Baaltegas, Tochter des blswry, jener (ist) vom
5 Stamm der Söhne gdybwls, seine Mutter, und für ihn und für seine Kinder zu ihrer Ehre.
Ausgehend von der Datierung, seiner Genealogie, seiner Stammeszugehörigkeit und der seltenen Sprachvarianten kann Hairan mit der Person gleichen Namens aus zwei weiteren Inschriften identifiziert werden: Einer bilingualen griechisch-aramäischen Ehrinschrift aus dem Jahr 56 n. Chr. in welcher er von den Priestern des Bel-Tempels geehrt wird, sowie einer trilingualen Ehrinschrift aus dem Jahr 74 n. Chr., die ihm von der Boule Palmyras errichtet wurde.
Durch diese Identifikationen steigt unser Wissen über Hairan sprunghaft an: Von einem bloßen Namen auf einer Grabgründungsinschrift wird er zum Sohn einer aus einem anderen Stamm gebürtigen Mutter, der über mehrere Jahrzehnte hinweg die politische Landschaft in Palmyra prägte: Die Priester des Bel waren das prestigereichste religiöse Kollegium Palmyras und Hairan ist der einzige Palmyrener, dem die Boule jemals ihren Dank in einer trilingualen Inschrift ausdrückte. Höchstwahrscheinlich hatte die politische Bedeutung der Familie des Hairan auch nach seinem Tod weiterhin Bestand, denn der Name seines Vaters und seines Großvaters wurden weiter vererbt: Im Jahr 135 n. Chr. findet sich ein Bonnes, Sohn des Bonnes, Sohn des Hairan als Vorsitzender eben der Boule, die siebzig Jahre zuvor seinen Großvater ehrte.
*Lesung der griechischen Datierung nach IGLS XVII 535.
Weitere Lektüre:
Eleonora Cussini / Delbert Hillers: Palmyrene Aramaic Texts, Boston 1996
Palmira Piersimoni, The Palmyrene Prosopography, London 1995
Jean-Baptiste Yon, Les Notables de Palmyre, Beirut 2002